| Autor: | Bitzer EM, Grobe TG, Dörning H | |
| Keywords: | Atopische Dermatitis, Psoriasis, Komplementärmedizin, Therapieverfahren, Studie, Neurodermitis | |
| Abstract: | Therapeutische Maßnahmen bei atopischer Dermatitis bei Kindern bzw. Erwachsenen und bei Psoriasis wurden in einer Studie mit Fragebögen untersucht. Patienten wurden retrospektiv zu den in Anspruch genommenen Therapieverfahren befragt sowie zu dem subjektiv wahrgenommenen kurzfristigen und langfristigen Nutzen der Behandlungen. Es wurden eine Reihe schulmedizinischer, naturheilkundlicher und komplementärmedizinischer Therapiemethoden ausgewertet und miteinander verglichen. Die Untersuchung wurde im Auftrag der GEK vom Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsforschung (ISEG) durchgeführt. | |
| Copyright: | Copyright der Texte: Gmünder
ErsatzKasse GEK
Copyright der HTML-Gestaltung: Patienteninformation für Naturheilkunde |
|
| Info Jockey's
Comment: |
Die vorliegende Studie befragt sehr detailiert
zu den einzelnen Verfahren und vergleicht danach eine "schulmedizinische"
und eine "komplementärmedizinische" Gruppe von Therapieverfahren.
Dieser Gruppenvergleich läßt komplementäre Verfahren in
der Bewertung etwas schlechter abschneiden als klassische Verfahren. Dieses
Ergebnis ist auf den ersten Blick für naturheilkundlich Interessierte
erstaunlich, wie kommt es zustande? In der Gruppierung
wurden die besonders wirksamen klassischen Naturheilverfahren Klimatherapie
und Ernahrungstherapie sowie die Psychotherapie zu der Gruppe Schulmedizin
gezählt, da sie allgemein anerkannt und erstattungsfähig sind.
Es lohnt sich also die Auswertung dieser interessanten Untersuchung genau
durchzulesen!
Besonders für Therapeuten und Patienten interessant ist die Frage, welche Erfolge eine integrative, ganzheitliche Behandlung hätte, die Klimatherapie, Ernährungstherapie, Psychosomatik und andere in synergistischer Weise mit einander verbindet. In diese Richtung sollte weiter geforscht werden! [IJBH] |
|
Die Befragten wurden unter der Voraussetzung entsprechender Therapieerfahrungen um eine Einschätzung der im Fragebogen aufgeführten Behandlungsmaßnahmen gebeten. Dabei wurde neben der globalen Einstufung des Behandlungserfolges die persönliche Einschätzung der kurzfristigen und längerfristigen Wirkung der Behandlungsmaßnahme auf die Hautveränderungen sowie die Beeinträchtungung durch die jeweilige Therapie erfragt. Zur Einschätzung konnte zwischen jeweils vier Beurteilungsstufen gewählt werden (”keine Wirkung” bzw. ”kein Erfolg”, ”keine Beeinträchtigung” über die Kategorien ”kaum” und ”mäßig” bis zu ”starke Verbesserung”, ”starke Beeinträchtigung” oder ”großer Erfolg”).
In den nachfolgenden Abschnitten und in den zugehörigen Abbildungen werden die Häufigkeitsverteilungen der Antworten nacheinander für die vier genannten Bewertungsdimensionen dargestellt. Die Darstellung beschränkt sich dabei auf Behandlungsformen, deren Anwendung von mindestens 10 Befragten im Fragebogen angegeben worden war (vgl. Tabelle 29).
Auch unter den intern angewendeten Behandlungsmaßnahmen wird eine Kortisontherapie, die in dieser Form jedoch nur in schweren Erkrankungsfällen indiziert ist, kurzfristig als verhältnismäßig wirksam eingestuft. Homoöpathische Behandlungen sowie Naturpräparate werden zurückhaltend beurteilt.
Eine vergleichbare geringe kurzfristige Wirksamkeit wird auch bei der Einschätzung diätetischer Maßnahmen sowie bei Entspannungstechniken und Psychotherapie angegeben. Demgegenüber werden die weiter verbreiteten Therapieverfahren auf Basis oder unter Einbeziehung von UV-Bestrahlung, wozu im weitesten Sinne auch Reizklimaaufenthalte gezählt werden können, durchgängig als verhältnismäßig wirksam eingestuft.
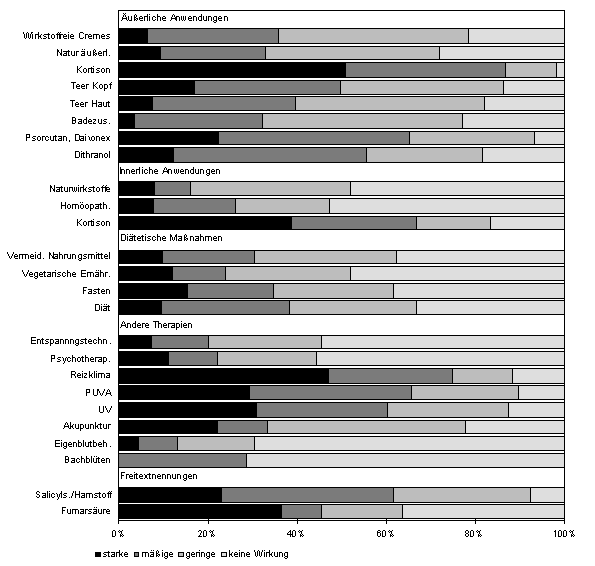
Abbildung 15: Kurzfristige Wirkung
von Behandlungsmaßnahmen (Psoriasis)
Unter den komplementärmedizinischen Maßnahmen im engeren Sinne weist Akupunktur die vergleichsweise beste Wirkungseinschätzung auf, Eigenblutbehandlung und Bachblütentherapie sind in bezug auf alle bewerteten Therapien diejenigen mit der geringsten kurzfristigen Wirksamkeit.
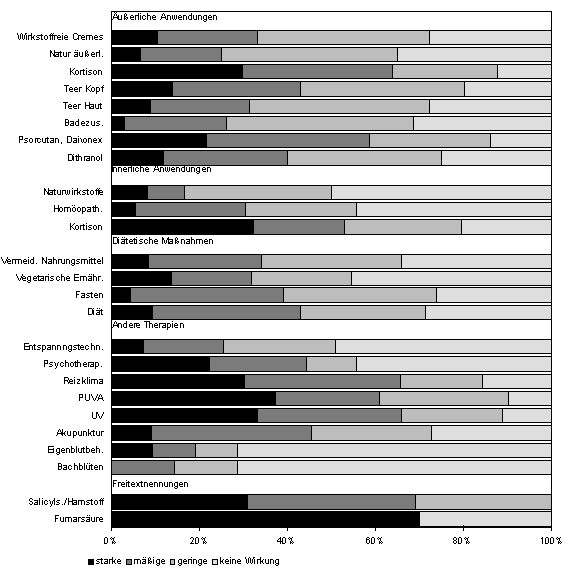
Abbildung 16: Längerfristige Wirkung von Behandlungsmaßnahmen (Psoriasis)
Für die Mehrzahl der Behandlungsmaßnahmen finden sich Einschätzungen der längerfristigen Wirkung, die nur wenig von der angegebenen kurzfristigen Wirksamkeit abweichen. So zählt auch im Hinblick auf die längerfristige Wirksamkeit die externe Kortisonanwendung zu den am positivsten bewerteten Behandlungsmaßnahmen. Ihre Wirksamkeit wird allerdings wie auch die der internen Kortisonanwendung längerfristig im Mittel geringer eingeschätzt. Eine entsprechende Aussage gilt auch für Reizklimaaufenthalte, die in ihrer längerfristigen Wirksamkeit zurückhaltender beurteilt werden und bezüglich dieser Bewertungsdimension nahezu identische Ergebnisse wie die UV-Strahlenbehandlungen (PUVA sowie übrige UV-Behandlungen) aufweisen.
Diätetische Maßnahmen sowie Entspannungstherapien werden ausgehend von einem eher niedrigen kurzfristigen Potential in ihrer längerfristigen Wirkung geringgradig besser eingeschätzt.
Zu Maßnahmen, die in der längerfristigen Wirksamkeit deutlich besser eingestuft werden, können lediglich die Psychotherapie sowie interessanterweise die Fumarsäuretherapie gerechnet werden, der 7 von 10 Anwendern sogar eine starke längerfristige Wirksamkeit bescheinigen. Allerdings sollten diese Ergebnisse vor dem Hintergrund der geringen Anzahl von zugrundeliegenden Beobachtungen nur zurückhaltend interpretiert werden.
Bei einem Vergleich der Darstellungen zur Wirksamkeit imponiert zunächst der relativ hohe Anteil von Befragten ohne therapiebedingte Beeinträchtigungen bei einer Vielzahl von Behandlungsmaßnahmen. Eine Ausnahme bildet die Fumarsäure, für deren Anwendung nahezu alle Patienten eine zumindest geringe und noch mehr als ein Drittel der Anwender eine starke Beeinträchtigung angeben.
Aus Patientensicht weiterhin als verhältnismäßig nebenwirkungsträchtig wird die innere Anwendung von Kortisonpräparaten gefolgt von der PUVA-Therapie eingestuft. Etwas geringere Beeinträchtigungen werden für die äußeren Anwendungen von Dithranol, Teer- sowie Kortisonpräparaten angegeben.
Alle abgefragten komplementärmedizinischen Behandlungsmethoden mit Ausnahme des Fastens zeigen ausgesprochen geringe Einstufungen der Beeinträchtigung.
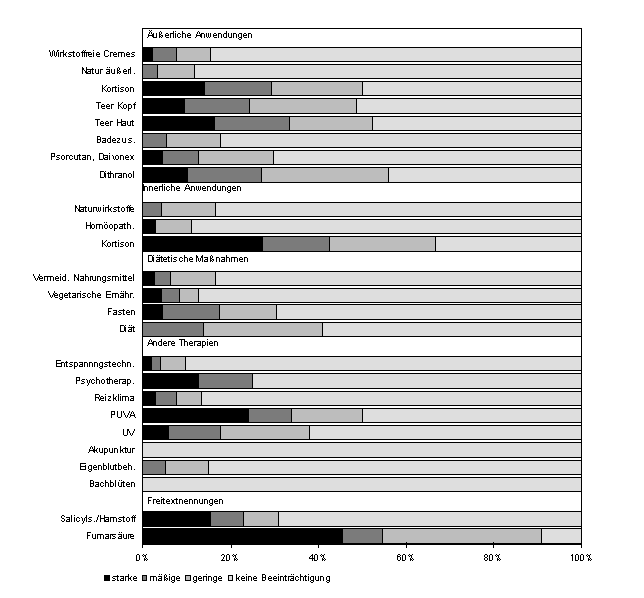
Abbildung 17: Beeinträchtigung durch Behandlungsmaßnahmen (Psoriasis)
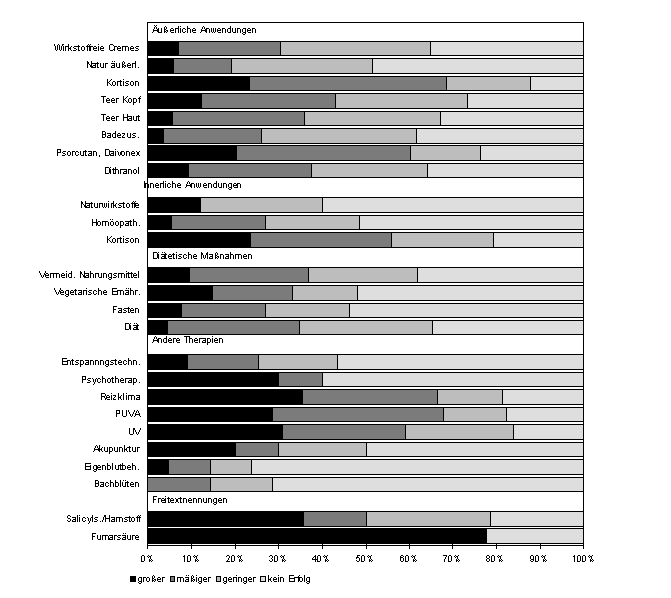
Abbildung 18: Erfolg von Behandlungsmaßnahmen
(Psoriasis)
Eine Gegenüberstellung von Angaben zur Erfolgseinschätzung insgesamt sowie von Angaben zur Einschätzung der längerfristigen Wirksamkeit zeigt i.d.R. nur marginal abweichende Ergebnisse. Auf eine erneute Erläuterung der einzelnen Therapiebewertungen kann an dieser Stelle daher verzichtet werden. Die Erfolgsbewertung der aufgeführten Therapiemaßnahmen insgesamt hängt in der Untersuchungspopulation demnach nahezu ausschließlich von ihrer längerfristigen Wirksamkeit ab bzw. wird übereinstimmend eingestuft und kaum vom Ausmaß der Nebenwirkungen bzw. Beeinträchtigungen modifiziert.
Zum einen lassen sich die Zusammenhänge der Bewertungsdimensionen im Rahmen der Bewertung einzelner Therapien separat betrachten, zum anderen können die Bewertungen der verschiedenen Therapien in unterschiedlichen Dimensionen miteinander verglichen werden.
”Kurzfristige Wirkung” vs. ”längerfristige Wirkung”
Die Darstellung verdeutlicht nochmals die bereits beschriebene weitgehende Übereinstimmung in der Einschätzung von kurzfristiger und längerfristiger Wirkung. Augenfällig sind drei Abweichungen. Die kurzfristig deutlich positiver bewertete kurzfristige Wirkung der externen Kortisontherapie sowie die längerfristig günstiger bewertete Psychotherapie und Fumarsäurebehandlung.
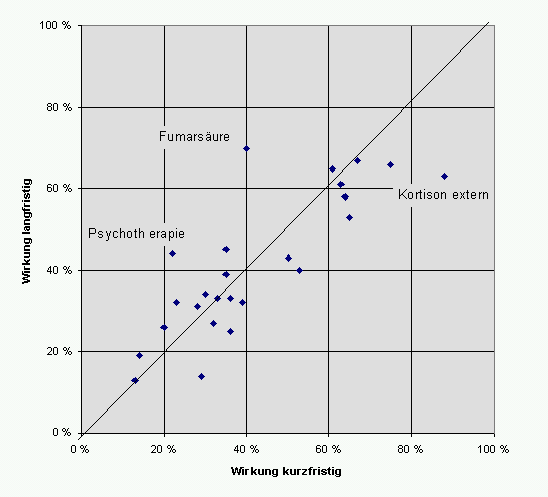
Abbildung 19: Längerfristige vs. kurzfristige Wirkung von Behandlungsmaßnahmen (Anteil Anwender mit mind. mäßiger Wirkung); r = .82
”Erfolg insgesamt” vs. ”längerfristige Wirkung”
Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht die im Hinblick auf die Gruppenergebnisse der jeweiligen Anwender nahezu perfekte Übereinstimmung der Einschätzungen von längerfristiger Wirkung sowie der Erfolgsbewertung insgesamt. Für den dargestellten Zusammenhang der Therapieeinschätzungen ergibt sich so ein Korrelationskoeffizient von r = .99.
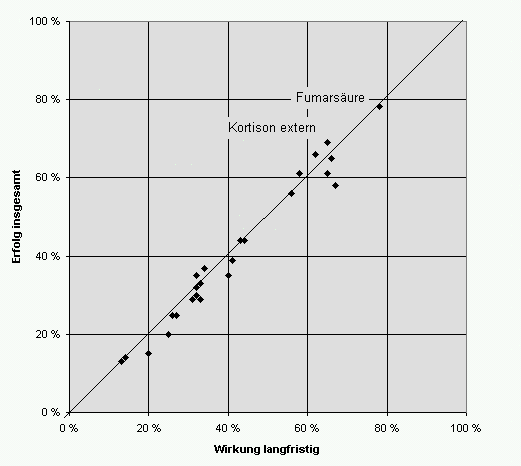
Abbildung 20: Erfolg insgesamt vs. längerfristige Wirkung von Behandlungsmaßnahmen (Anteil Anwender mit mind. mäßiger Wirkung); r = .99
”Beeinträchtigung” vs. ”längerfristige Wirkung”
Ein etwas anderes Bild ergibt sich bei der Gegenüberstellung von Beeinträchtigung und längerfristiger Wirkung. Wirksamere Behandlungsmaßnahmen sind demnach nicht zwangsläufig mit einer höheren Beeinträchtigung verbunden. Zu Maßnahmen mit verhältnismäßig großer Wirksamkeit bei geringen Beeinträchtigungen zählen Reizklimaaufenthalte, Calcipotriolanwendung sowie UV-Bestrahlung.
Verhältnismäßig hohe Beeinträchtigungswerte bei gleichzeitig guter Wirksamkeit zeigen demgegenüber interne Anwendungen von Kortison und Fumarsäure.
Interessanterweise werden im Mittel aus der Sicht der jeweiligen Anwender
bis auf eine Ausnahme (Teerpräparate zur Hautbehandlung) Therapiemaßnahmen
in ihrer Wirksamkeit auf den vorgegebenen vierstufigen Skalen grundsätzlich
höher eingeschätzt als bezüglich ihrer Nebenwirkungen. So
können auf Basis der Befragungsangaben keine Behandlungsmaßnahmen
explizit als schädlich in dem Sinne eingestuft werden, daß die
durch ihre Anwendung zu erwartende Beeinträchtigung höher als
die erwartete Wirkung auf die Hautveränderungen wäre.
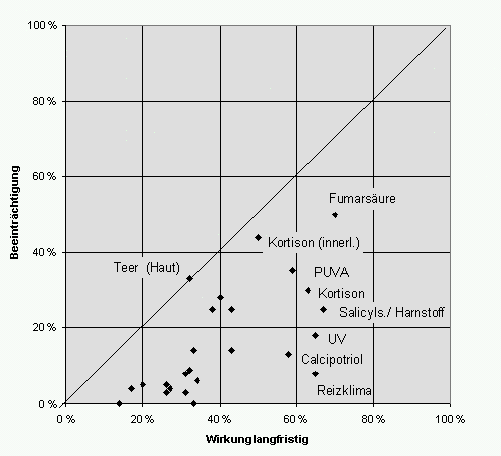
Abbildung 21: Beeinträchtigung
vs. längerfristige Wirkung von Behandlungsmaßnahmen (Anteil
Anwender mit mind. mäßiger Wirkung bzw. Beeinträchtigung);
r = .65
Die Identifizierung von potentiell an einer Psoriasis erkrankten Personen wurde über Abrechnungsscheine ambulant tätiger Hautärzte vorgenommen, die der Schwäbisch Gmünder Ersatzkasse (GEK) für das 4. Quartal 1995 vorlagen. Bei einem Anteil von 5,1% hautärztlicher Krankenscheinen mit der Diagnose Psoriasis erwies sich dieser Zugangsweg grundsätzlich als praktikabel, ist jedoch mit einigen Limitationen verbunden:
Der Rücklauf von 78% unter den angeschriebenen 15-59jährigen Patienten mit der Krankenscheindiagnose einer Psoriasis kann für eine schriftlich-postalische Befragung als äußerst zufriedenstellend angesehen werden. Systematische Verzerrungen der Ergebnisse sind in diesem Zusammenhang somit kaum zu erwarten.
Als Kriterium zur Aufnahme in die Studienauswertung wurde die Anwort auf die Eingangsfrage des Erhebungsbogens nach dem Vorliegen einer Psoriasis bzw. einer Schuppenflechte herangezogen. Diese Frage wurde von 18% der Befragten verneint. Eine Ursache hierfür könnte insbesondere in nur mangelhaft validen Diagnoseangaben auf Abrechnungsscheinen liegen. Daß einem entsprechend erkrankten Patienten die Bezeichnung der Diagnose nicht geläufig ist, erscheint in Anbetracht der umgangssprachlich gebräuchlichen Bezeichnung bei der Diagnose einer ”Schuppenflechte” eher unwahrscheinlich.
In der Studienpopulation wurde eine Reihe soziodemographischer sowie erkrankungsspezifischer Parameter erhoben. Gemessen an der Altersstruktur innerhalb der GEK waren die 15 - 29jährigen Versicherten in der Gruppe der hautärztlich behandelten Psoriatiker leicht unterrepräsentiert. Das Geschlechtsverhältnis in der Untersuchungspopulation entsprach weitgehend dem der GEK-Versicherten, was in Übereinstimmung mit den Erwartungen bei einer geschlechtsunabhängig auftretenden Erkrankung steht.
Die mittlere Erkrankungsdauer betrug zum Befagungszeitpunkt 14 Jahre, mehr als die Hälfte der Befragten waren bereits vor Vollendung des 25. Lebensjahres erkrankt. Die aktuellen erkrankungsbedingten Beschwerden wurden auf einer von Finlay (1994) in Großbritanien entwickelten Skala im Mittel mit 25,2% des maximal erfaßbaren Beschwerdescores angegeben. Dieser Wert stimmt gut mit dem von Finlay angegebenen Wert von 29,7% für ambulant in einer Universitätsklinik behandelte Psoriatiker überein (für Kontrollpersonen ohne Hauterkrankungen war dort ein Wert von 1,6% ermittelt worden, über das gesamte Spektrum der ambulant behandelten Hautpatienten betrug der Wert 24,2%). Der Vergleich von Beschwerdeangaben auf zwei visuellen Analogskalen zeigt, daß die Patienten i.d.R. gemessen am aktuellen Zustand in der Vergangenheit bereits von deutlich schwereren Erkrankungsphasen betroffen waren.
Bei maximal 32 möglichen Nennungen wurden von den Patienten im Mittel Anwendungserfahrungen mit 5,9 unterschiedlichen Behandlungsmaßnahmen angegeben (Median: 5). Da im Erhebungsbogen einzelne Therapien bzw. Therapieformen zu Kategorien zusammengefaßt werden, ist dieser Wert allerdings in erster Linie für Vergleiche von Subgruppen innerhalb der Studie von Bedeutung, wo er als ein relatives Maß für die Behandlungsvielfalt herangezogen werden kann.
Als Determinanten der Behandlungsvielfalt konnten folgende Variablen in multivariaten logistischen Regressionsmodellen identifiziert werden:
Im Spektrum der angewendeten Behandlungsmaßnahmen überwiegen klassisch-schulmedizinische Therapieansätze. So geben über 70% der Befragten Therapieerfahrungen mit kortisonhaltigen Salben an. Die externe Kortisontherapie ist damit - neben der Anwendung von wirkstoffreien Cremes (z.B. Fettcremes) - die am häufigsten genannte Behandlungsmaßnahme. In der Rangfolge ihrer Häufigkeit von Anwendungserfahrungen folgen UV-Bestrahlungen (56%, wobei 21% der Patienten explizit eine PUVA-Therapie angeben), Teerpräparate zur Kopfhautbehandlung (54%), Badezusätze (37%), Reizklimaaufenthalte (35%) sowie Teerpräparate zur Hautbehandlung und Vitamin-D3-Analoga mit je 33%.
Ausgehend von einer weit gefaßten Definition verfügen lediglich 40% der Befragten über Erfahrungen mit komplementärmedizinischen Behandlungsmaßnahmen. Der Anteil von Anwendern komplementärmedizinischer Behandlungen reduziert sich auf 27%, sofern die alleinige Angabe von Präparaten zur äußeren oder inneren Anwendung ”... mit Wirkstoffen aus der Natur” nicht als hinreichendes Kriterium zur Klassifizierung dieses Anwenderkreises gewertet wird. Unter den verbleibenden komplementärmedizinischen Therapiemaßnahmen spielen neben ”vegetarischer Ernährung” und ”Fasten” insbesondere homöopathische Behandlungen sowie die Eigenblutbehandlung anteilig eine verhältnismäßig bedeutsame Rolle.
Als Prädiktoren der Anwendung von komplementärmedizinischen Verfahren erweisen sich in der Untersuchungspopulation die maximale Beeinträchtigung und die Anzahl der Hautlokalisationen sowie das Geschlecht, wobei Frauen mit größerer Wahrscheinlichkeit komplementärmedizinische Maßnahmen in Anspruch nehmen. Anwender komplementärmedizinischer Behandlungsmaßnahmen verfügen in der untersuchten Population im Mittel gleichzeitig auch über größere Anwendungserfahrungen bezüglich allopathischer Therapiemaßnahmen, was den Schluß nahe legt, daß komplementärmedizinische Methoden i.d.R. ergänzend und insbesondere bei schwereren Erkrankungsverläufen eingesetzt werden.
Zur Bewertung der Behandlungsmaßnahmen wurde nach der kurzfristigen und längerfristigen Wirkung auf die Hautveränderungen, nach der mit einer Behandlung verbundenen Beeinträchtigung sowie nach dem Erfolg der Maßnahme insgesamt gefragt. Dargestellt wurden Bewertungen, sofern zumindest 10 Befragte eine Anwendung der jeweiligen Maßnahme angegeben hatten.
Während therapiebezogen in einigen plausiblen Fällen mäßig divergierende Einschätzungen der kurz- und längerfristigen Wirkung resultierten, zeigten die Einstufungen des Erfolges und die der längerfristigen Wirkung nahezu identische Ergebnisse. Die therapiebedingten Beeinträchtigungen wurden dabei durchgängig für alle Therapien (mit Ausnahme von Teerpräparaten zur Hautbehandlung) auf der vorgegebenen vierstufigen Bewertungsskala im Mittel geringer als die Wirkung der jeweiligen Maßnahme eingeschätzt.
Zu Behandlungsmaßnahmen mit hoher Wirksamkeit, die jedoch gleichfalls mit einer hohen Beeinträchtigung aus Sicht der Anwender verbunden sind, zählen insbesondere die interne bzw. systemische Kortisontherapie sowie die Fumarsäurebehandlung, wobei die Bewertungen der Fumarsäurebehandlung bei der nur geringen Anzahl von vorliegenden Patienteneinschätzungen vorsichtig interpretiert verden sollte. Im Bericht nicht näher dargestellte Subgruppenanalysen belegen, daß Patienten, die diese beiden Therapien angewendet hatten, überdurchschnittlich schwere Erkrankungsverläufe aufwiesen. Die Beobachtung entspricht den Erwartungen, die sich aus der auf schwere Erkrankungsverläufe beschränkten Indikationsstellung der Therapien ergibt.
Eine relativ hohe Wirksamkeit bei einer gegenüber der systemischen Kortisontherapie etwas geringeren Beeinträchtigungs- bzw. Nebenwirkungseinschätzungen weist die PUVA-Therapie auf, die gleichfalls eher bei schwereren Erkrankungsverläufen indiziert ist.
Eine mittlere Beeinträchtigung bzw. Nebenwirkungsrate bei guter Wirksamkeit wird der externen Kortisonanwendung, der UV-Bestrahlung (unter Ausnahme der PUVA-Therapie) sowie der Therapie mit keratolytisch wirksamen Salicylaten bzw. Harnstoffpräparaten bescheinigt. Eine gute Wirksamkeit bei nur geringen Nebenwirkungen ergibt sich für die Anwendung von Vitamin-D-3-Analoga sowie für Reizklimaaufenthalte. Alle in diesem Abschnitt genannten Behandlungsmaßnahmen sind auch bei leichteren Erkrankungsverläufen indiziert und werden nach den vorliegenden Befragungsergebnissen häufig angewendet, was vor dem Hintergrund der günstigen Relation von angegebener Wirkung und Nebenwirkung verständlich und folgerichtig erscheint.
Die gleichfalls relativ häufig verwendeten Teerpräparate werden bezüglich ihrer Wirkung bei mäßiger Beeinträchtigung zurückhaltender interpretiert. Applikationen zur Hautbehandlung weisen dabei eine ausgesprochen ungünstige Relation von Wirkung und Beeinträchtigung auf, wobei insbesondere subjektive Beeinträchtigungen eine bekannte Limitation der Teeranwendung darstellen.
Eine den Teerpräparaten aus Patientensicht vergleichbare Wirkung besitzen spezielle diätetische Maßnahmen, Dithranolpräparate sowie die allerdings nur von wenigen Befragten angegebene Psychotherapie.
Keine der komplementärmedizinischen Maßnahmen verursachte nach Einschätzung der überwiegenden Zahl ihrer Anwender wesentliche Beeinträchtigungen, allerdings wurden gleichfalls die Wirkungen der Maßnahmen auf die Hautveränderungen im Mittel für die einzelnen Maßnahmen nur als gering eingestuft.
Insgesamt läßt sich feststellen, daß komplementärmedizinische Maßnahmen vorrangig bei schwereren Erkrankungsverläufen von einem nicht unerheblichen Teil der Patienten und insbesondere Patientinnen angewendet werden. Komplementärmedizinische Maßnahmen stellen jedoch in ihrer Bedeutung - zumindest in einer hautärztlich behandelten Patientenpopulation - eher eine Ergänzung der i.d.R. als wirksamer eingestuften schulmedizinischen Therapiestrategien dar.
|
|